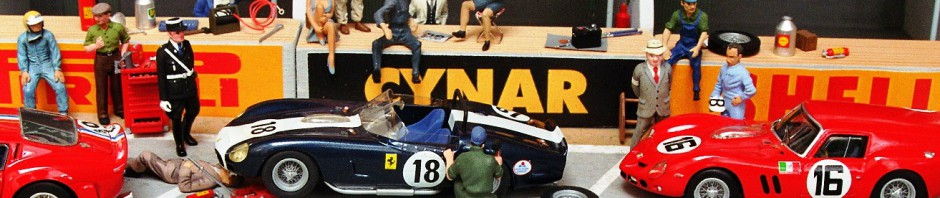Unter dem Themenbereich „Sportwagen-Geschichte“ (siehe Editorial) wurden 14 Berichte eingestellt, die die Jahre 1947 bis 2011 zum Gegenstand haben (Berichte datiert auf 2011). Diese „Episoden“ befassen sich in chronologischer Reihenfolge jeweils mit dem Saisonverlauf einiger Jahre, mit den erfolgreichsten Fahrzeugen und Fahrern, den Ergebnissen wichtiger Langstreckenrennen und Modellen in 1/43. Dabei folgen die Saisonwertungen einem über alle Jahre einheitlichen Konzept, sie unterscheiden sich damit von den häufig wechselnden Wertungen der verschiedenen Meisterschaften und Pokale der mittlerweile fast 80jährigen Nachkriegsgeschichte. Außerdem konzentrieren sich die Minerva-Statistiken auf Endurance-Rennen: Rennen über kürzere Distanzen werden nicht betrachtet, auch wenn sie gelegentlich Eingang in die offiziellen Meisterschaften fanden.
Anmerkungen zu Quellen finden sich am Ende dieses Textes.
Den Zugang zu den Episoden erlangt man am besten über zwei einführende Berichte unter der Rubrik „Sportwagen-Geschichte“, die sich auf die Epochen 1947-1981 und 1982-2011 beziehen.
Weitere Statistiken über den gesamten Zeitraum 1947-2025 in Form von Übersichten und Tabellen:
(1) Jahreswertung für die Hersteller („Marken“), Wertung auf Basis der Plätze 1 bis 6 in allen wichtigen jährlichen Langstreckenrennen. Tabelle (Hersteller) mit Erläuterungen (Wertungsmodus) sowie einer Liste der punktbesten Hersteller über die einzelnen Jahre des Zeitraums 1947 bis 2025 („Minerva“-Wertung) und der offiziellen Marken-Wertungen im Rahmen der (FIA-) Weltmeisterschaften oder anderer wichtiger Weltpokale.
Zu (1): Resultate 2025 für die Hersteller
Minerva-Punktwertung, WEC (8 Rennen): Ferrari 60 Pkt. / Porsche 30 / Cadillac 21 / Toyota 21 / Alpine 18
Minerva-Punktwertung, IMSA (Endurance Cup, 5 Rennen): Cadillac 31 Pkt. / Porsche 27 / Acura 26 / BMW 8
Gesamtwertung WEC + IMSA Endurance (13 Rennen): Ferrari 60 Pkt. / Porsche 57 / Cadillac 52 / Acura 26 / Toyota 21 / Alpine 18
Die WEC-Wertung nach den „Minerva“-Regeln ging 2025 klar und deutlich an Ferrari. Maranello gewann die ersten drei Rennen der Saison und danach auch noch in Le Mans, in der zweiten Saisonhälfte folgten noch ein zweiter und dritter Platz des besten Autos. Vier andere Teams schafften jeweils einen Sieg. Porsche lag am Ende mit Respektabstand auf Rang 2 vor Cadillac und gleichauf Toyota.
Die IMSA-Endurance-Wertung nach den „Minerva“-Regeln ging an Cadillac, knapp vor Porsche und Acura. Ferrari und Toyota traten in der IMSA-Serie bekanntlich nicht an. Porsche und Cadillac holten in den fünf Rennen jeweils zwei Siege, ein Sieg ging an Acura.
Zum Vergleich: Auch die offizielle WEC-Wertung ging an Ferrari (Werksteam). Die IMSA-Gesamtwertung (9 Sprint- und Endurance-Rennen) gewann Porsche, und der deutsche Hersteller gewann auch den Endurance Cup (5 der 9 IMSA-Rennen) vor Cadillac.
In der Gesamtbilanz aus 8 WEC- und 5 IMSA Endurance-Rennen holten die drei Topteams Ferrari, Porsche und Cadillac zusammen 10 Siege in den 13 Rennen (Ferrari 4 / Porsche und Cadillac 3). Ferrari reichten die 60 Punkte aus der WEC-Wertung, um sich knapp vor Porsche (57) und Cadillac (52) zu behaupten. Zum ersten Mal seit 1972 gewann Ferrari also die Endurance-Jahreswertung nach den „Minerva“-Regeln. Die Verlierer der Saison waren Toyota und Peugeot, die nur in der WEC starteten, und BMW.
(2) Jahreswertung für die Piloten, Wertung auf Basis der Plätze 1 bis 6 in allen wichtigen jährlichen Langstreckenrennen. Tabelle (Fahrer) mit Erläuterungen (Wertungsmodus), sowie einer Liste der punktbesten Fahrer über die einzelnen Jahre des Zeitraums 1947 bis 2025 („Minerva“-Wertung) und der offiziellen Fahrer-Wertungen im Rahmen der (FIA-) Weltmeisterschaften oder anderer wichtiger Weltpokale.
Zu (2) Resultate 2025 für die Fahrer, Minerva-Punktwertung (WEC + IMSA Endurance, 13 Rennen):
Hier gibt es einen eindeutigen Sieger: Porsche-Pilot Laurens Vanthoor (Belgien) gewann mit seinen Teamkollegen drei Rennen, holte einmal Platz 2 und zweimal Platz 3. Besonderen Wert hat seine Bilanz, da er bei den beiden US-Klassikern Daytona und Sebring den Sieg holte und in Le Mans nur um gut 10 Sekunden geschlagen Platz 2 erreichte. Die unterschiedlichen Teamkollegen waren Estre, Campbell, Nasr, Tandy und Jaminet.
Hier die Minerva-Liste der neun punktbesten Piloten: Laurenz Vanthoor (Belgien, 18,8 Pkt.) / Kevin Estre (Frankreich, 13,8) / James Calado (GB, 12,3) / Antonio Giovinazzi (Italien, 12,3) / Alessandro Pier Guidi (Italien, 12,3) / Earl Bamber (Neuseeland, 11,0) / Philip Hanson (GB, 10,3) / Robert Kubica (Polen, 10,3) / Yifei Ye (China, 10,3).
Zum Vergleich: Die offizielle WEC-Fahrerwertung ging an das Ferrari-Team Calado, Giovinazzi, Guidi, die IMSA-Gesamtwertung (9 Sprint- und Endurance-Rennen) holten sich Matt Campbell (Australien) und Mathieu Jaminet (Frankreich) mit Porsche und die IMSA Endurance-Wertung ging an Felipe Nasr (Brasilien) und Nick Tandy (GB) mit Porsche.
Die Wertungen bei den vier klassischen Langstreckenrennen (Le Mans, Daytona, Sebring, Petit Le Mans) ging bei den Herstellern klar an Porsche, mit drei Siegen in Le Mans, Daytona und Sebring. Bei den Fahrern waren ebenfalls Porsche-Piloten ganz vorn: Vanthoor und Campbell erreichten vier Podiumsplätze, Vanthoor mit zwei Siegen, einem zweiten und einem dritten Platz, und Campbell mit zwei zweiten und zwei dritten Plätzen. Nasr und Tandy erreichten zwei Siege und Estre zwei zweite und einen dritten Platz.
(3) Piloten-Rangliste für den gesamten Zeitraum 1947-2025, Zahl der Siege in den wichtigen Langstreckenrennen über den gesamten Zeitraum. Mit einem Text zur Erläuterung des Berechnungsmodus und einer Tabelle mit der Rangliste der 50 punktbesten Piloten. Außerdem kann eine Übersicht der für die Pilotenwertung herangezogenen Langstreckenrennen aufgerufen werden.
Vielleicht mehr noch als die Bilanz für einzelne Piloten kommt bei Langstreckenrennen natürlich die besondere Rolle der Fahrerteams ins Spiel. Ein Bericht über die berühmten und erfolgreichen „Dream-Teams“ der Le Mans-Geschichte kann hier aufgerufen werden.
Quellen
zu den Ergebnissen der Langstreckenrennen über die Jahre seit 1947 – gestern und heute:
Bis in die 1990er Jahre mussten die Informationen zu den Rennergebnissen analog aus Büchern oder Magazinen gewonnen werden. Beispielhaft für periodische Magazine und Jahrbücher sind:
„Motor Revue“ (deutsches Journal, vierteljährig, 1951-1994) / „Powerslide“ (Monatszeitschrift, Schweiz, 1963-1994) / „Auto Jahr“ (Jahrbuch u.a. in deutscher Sprache, hrsg. von Edita Lausanne, Schweiz, ab 1953),
sowie die im deutschsprachigen Raum bekannte Zeitschriften „Rallye Racing“ (1996-2001), „Auto, Motor & Sport“ und „Motorsport Aktuell“ (ab 1975).
Ein Meilenstein am Ende der analogen Ära waren die beiden Bände „Time and Two Seats: Five Decades of Long Distance Racing“ von János L. Wimpffen (Motorsports Research Group, Redmond 1999, Umfang über 2200 Seiten). Es war das bis dahin umfassendste Kompendium der Endurance Szene in Text und Tabellen, heute nur noch im Antiquariat-Handel zu Preise um die 1000 € erhältlich.
Das Thema „Le Mans“ ist natürlich besonders gut dokumentiert, vor allem durch diverse Bücher und Jahresbände, die vom ACO (Automobile Club de l´Ouest) autorisiert sind und für die meist die beiden französischen Autoren Moity und Tessèidre stehen. Hinzu kommt die Reihe von Quentin Spurring „Le Mans – The Official History of the World´s Greatest Motor Race“, die sieben Bände behandeln jeweils Zehnjahresabschnitte, von 1923-1929 bis 1990-1999, ebenfalls unter der ACO-Lizenz.
Automobile Club de l´Ouest (Hrsg.), 24 Stunden von Le Mans, Die offizielle Chronik des berühmtesten Langstreckenrennens (2 Bände), Heel, 2010
Christian Moity, The Le Mans 24-Hour Race 1949-1973, Edita Lausanne, 1974
Christian Moity, Endurance – 50 Ans d´Historie 1953-1963, ETAI, o.J.
Chrisitan Moity, Jean-Marc Tessèidre, Alain Bienvenu, 24 Heures du Mans 1923-1992 (2 Volumes), J.-P. Barthelemy, 1994
Le Mans Jahrbücher des ACO, jährlich ab 1978 bis 2025 (mit Sonderteilen für die Jahre 1974-1977)
Seit ca. 30 Jahren rücken diverse Internet-Seiten immer stärker in den Fokus, darunter u.a.: „racingsportscars“ (Statistisches Werk aller Sportwagen-Ergebnisse bis heute) / „wsrp.ic.cz“, tschechische Seite, ebenfalls mit einer umfassenden Statistik der Sportwagen-Resultate, auch für „Non Championship Races“
Und für die Modellsammler besonders interessant: „lm24database“, die Webseite stellt für alle Le Mans-Autos seit 1923 eine Übersicht über die produzierten Modelle in 1/43 zusammen.